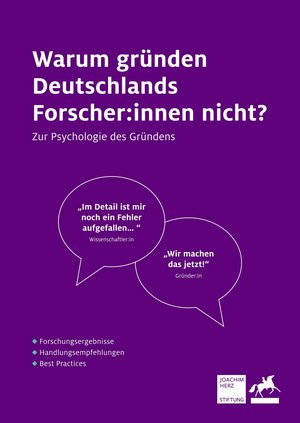Studien & Forschungsprojekte

Wir setzen uns gezielt für anwendungsorientierte Forschung und den Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft ein. Dazu fördern wir Studien, die zu unseren Stiftungsschwerpunkten passen und die Arbeit in diesen Themenfeldern besonders voranbringen.
In der Studie zu "Adaptives Lernen" erforschten Wirtschaftsdidaktiker:innen, Computerlinguist:innen und KI-Spezialist:innen die Grundlagen für eine adaptive KI-basierte Lernplattform im Bereich der ökonomischen Bildung. Das Forschungsprojekt "Warum gründen Deutschlands Forscher:innen nicht?" des Entrepreneurship Research Institute der Technischen Universität München setzte sich intensiv mit dieser Fragestellung auseinander und zeigt in der Publikation mögliche Gründe und Herausforderungen. Das Forschungsprojekt des iff - institut für finanzdienstleistungen e.V. ermittelt in einer repräsentativen Umfrage, wie es um die Kreditkompetenz junger Erwachsener in Deutschland bestellt ist und welche Mechanismen zur Stärkung beitragen können.
Studien auf einen Blick
Adaptive Lernplattform für den Wirtschaftsunterricht
Adaptives, KI-basiertes Lernen bietet die Chance, Lerninhalte individuell auf Schüler:innen anzupassen. Im Forschungsprojekt „Adaptive Learning in Economic Education (ALEE)“ schaffen Forscher:innen die Grundlagen für eine solche Lernplattform in der ökonomischen Bildung.
In interdisziplinärer Zusammenarbeit erforschen Wirtschaftsdidaktiker, Computerlinguisten und KI-Spezialisten die Grundlagen für eine adaptive KI-basierte Lernplattform in der ökonomischen Bildung.
Auf der Plattform erhalten Schüler:innen automatisiert Texte, Aufgaben und Rückmeldungen – abgestimmt auf ihren Leistungsstand. Damit findet Lernen auf dem jeweiligen lernförderlichen und somit motivierenden Niveau statt. So unterstützt die Lernplattform die Lehrpersonen bei der Gestaltung eines binnendifferenzierten Unterrichts.
Neben dem fachlichen Vorwissen und den Kompetenzen berücksichtigt die Plattform die individuellen kognitiven Eigenschaften und die Motivation der Schüler:innen. Zudem hilft die Lernplattform den Lehrpersonen abweichende Unterstützung durch das Elternhaus und bildungssprachlichen Fähigkeiten auszugleichen.
Beteiligte Wissenschaftler:innen:
- Prof. Dr. Ulf Brefeld (Leuphana Universität, Lüneburg)
- Prof. Dr. Dirk Loerwald (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Institut für Ökonomische Bildung, Oldenburg)
- Prof. Dr. Detmar Meurers (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Laufzeit: März 2021 – Juli 2024
Kreditkompetenz junger Erwachsener

Im Laufe unseres Lebens sind wir immer wieder mit finanziellen Engpässen konfrontiert. Insbesondere in jüngeren Jahren kann für größere Ausgaben wie Immobilienerwerb, Bildungsinvestitionen oder auch Konsumgüter nicht auf Ersparnisse zurückgegriffen werden. Ein Kredit kann dann eine Lösung sein, birgt aber auch Risiken. Der iff-Überschuldungsreport 2022 zeigt für Deutschland, dass bei 18,6 Prozent der Ratsuchenden in Schuldnerberatungsstellen die Überschuldungssituationen im Jahr 2021 vermeidbar gewesen wären. Um informierte Entscheidungen zu treffen, Kreditalternativen abzuwägen und die Folgen einzuschätzen, ist finanzielle Bildung der Grundstein.
Doch wie steht es um die Kreditkompetenz bei jungen Erwachsenen? Und wie kann diese gemessen werden? Im Forschungsprojekt des iff - institut für finanzdienstleistungen e.V. haben Forscherinnen ein umfassendes Messinstrument für Kreditkompetenz entwickelt und ermittelt, wie es um die Kreditkompetenz junger Erwachsener in Deutschland bestellt ist und welche Mechanismen zur Stärkung beitragen können.
Warum gründen Deutschlands Forscher:innen nicht?
Das Forschungsprojekt des Entrepreneurship Research Institute der Technischen Universität München untersucht erstmals wissenschaftliche und unternehmerische Identitäten an Universitäten.
Deutschland ist weltweit einer der Topstandorte für Spitzenforschung und Europas wettbewerbsfähigstes Land. Trotzdem liegt Deutschland als Gründungsstandort weit hinter anderen innovationsbasierten Volkswirtschaften zurück. Insbesondere die deutschen Universitäten schöpfen ihr unternehmerisches Potential noch nicht voll aus. Dabei könnte die Gesellschaft vom Know-how der Forscher:innen profitieren – z. B. durch neue Produkte, Dienstleistungen oder Arbeitsplätze.
Für Wissenschaftler:innen kann die Gründung eines Unternehmens ein vielversprechender Karriereweg sein. Paradox ist, dass die Einschätzung der Gründungschancen in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich steigt, die Zahl der Gründungen jedoch nicht. Liegt es an der herausfordernden Transformation von Wissenschaftlern zu Unternehmern, deren unterschiedlichen Identitäten bzw. Mindsets?
Gemeinsam mit der Joachim Herz Stiftung haben Prof. Dr. Dr. Holger Patzelt und Prof. Dr. Nicola Breugst vom TUM Entrepreneurship Research Institute aus München genau das untersucht. Ihr Forschungsprojekt „wissenschaftliche und unternehmerische Identitäten an Universitäten“ analysiert erstmals relevante, aber bisher vernachlässigte, psychologische Prozesse akademischer Ausgründungen. Dafür haben Deutschlands wohl renommierteste Entrepreneurship-Forscher ein interdisziplinäres Team aus der Gründungsforschung, Psychologie und Anthropologie zusammengestellt.
Das besondere an dem Forschungsprojekt ist, dass die Wissenschaftler:innen direkt in die Gründungsteams gingen, intensiv mit den Gründenden sprachen, sie über einen langen Zeitraum hinweg beobachten und befragten.
Die Ergebnisse zeigen, wie Wissenschaftler:innen zu erfolgreichen Gründern werden und helfen zu verstehen, welche Einflüsse diesen Prozess unterstützen oder hemmen. Sie helfen zu verstehen, wie interdisziplinäre Gründungsteams erfolgreich zusammenarbeiten, Kompromisse finden und gemeinsame Firmenwerte entwickeln. Außerdem geben sie Hinweise, wie Organisationen mehr Gründende hervorbringen können.
Laufzeit: Das Projekt ist lief über fünf Jahre von 2018 bis 2022.
Quellen:
Kontakt