Mit weißen Kügelchen gegen den Fluch der Ewigkeit
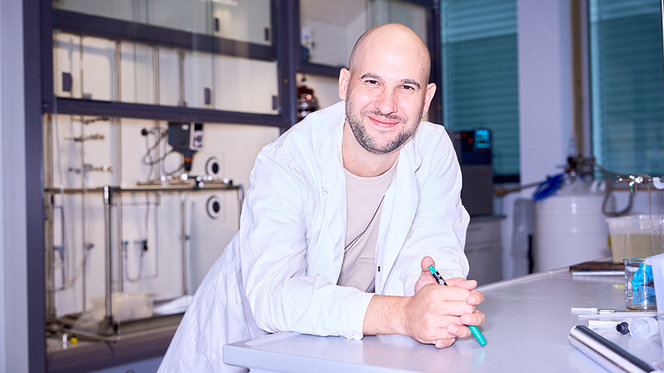
Sie sehen unscheinbar aus, doch in ihnen steckt eine große Idee: Mit biobasierten Adsorbern will der Chemiker Alejandro Lorente Sanchez die „Ewigkeitschemikalien“ PFAS aus unserem Wasser entfernen. Dafür wird er im Rahmen der innovate! academy der Joachim Herz Stiftung gefördert.
Wenn etwas von Dauer ist, kann das ein Segen sein – und es kann ein Fluch sein. Ob ein neuer, besser isolierter Fensterrahmen im Haus eingebaut wird, ob man sich ein neues Notebook kauft oder einfach eine Frühstücksdose – alles soll möglichst lang halten und nicht nach kurzer Zeit wieder ausgetauscht werden. Deshalb kommen zunehmend besonders haltbare und widerstandsfähige Materialien zum Einsatz. Manche sind unter dem Begriff Ewigkeitschemikalien bekannt, darunter auch PFAS, das sind besonders stabile synthetische Substanzen, die Plastik ähneln. „PFAS lassen sich praktisch nicht zerstören. Sie sammeln sich in der Umwelt an, unter anderem im Wasser. Das ist der Fluch der Ewigkeit“, sagt der Chemiker Dr. Alejandro Lorente Sanchez, der an der Freien Universität Berlin forscht.
So wird PFAS zu einem Problem, das droht, übermächtig zu werden: PFAS zirkulieren bereits in der Umwelt und im Wasserkreislauf. Zwar wird in Kläranlagen hierzulande bereits versucht, so viel PFAS aus dem Wasser zu binden, dass die Grenzwerte unterschritten werden und das Wasser als Trinkwasser genutzt werden kann. Dabei setzt man vor allem auf Aktivkohle. Doch die ist teuer und besonders bei kleinteiligen PFAS-Ketten nicht effizient. Sie muss außerdem häufig ausgetauscht werden. In manchen Klärwerken kommen auch Polymere zum Einsatz, man bekämpft dann im Grunde synthetische Substanzen mit synthetischen Substanzen, außerdem sind die Polymere ebenfalls teuer.
Alejandro Lorente Sanchez will einen anderen, praktikableren und nachhaltigeren Weg gehen. Um ihn dabei zu unterstützen, hat die Joachim Herz Stiftung ihn in die “innovate! academy” aufgenommen. Lorente Sanchez, wache Augen, aufgeschlossenes Lächeln, steht in einem Labor in einem Neubau des FU HUB Berlin im Stadtteil Lichterfelde. Er hält einen Glaszylinder von etwa 20 Zentimeter Länge hoch. Er ist gefüllt mit vielen weißen Kügelchen. Jedes hat einen Durchmesser von gerade einmal einem halben Zentimeter. „Unsere Waffe gegen PFAS. Der Zylinder soll einmal mehrere Meter lang sein und in jede Kläranlage integriert werden können. Das Wasser kommt an einer Seite des Zylinders hinein, und wenn es wieder hinausfließt, hat es etwa 90 Prozent weniger PFAS. Das ist der Plan“, sagt Lorente Sanchez.
"Ecosorb" – biobasierte Adsorbermaterialien
Die weißen Kügelchen sind der Kern der Technologie, die den Namen Ecosorb trägt: Es sind biobasierte Adsorbermaterialien, die gezielt PFAS binden. Lorente Sanchez gewinnt sie aus Resten von der Papier- und Holzindustrie sowie aus Resten von der Fischerei- und Meeresfrüchtebranche. Die in den Kügelchen enthaltenen Substanzen, die biobasierten Adsorbermaterialien, üben, vereinfacht gesagt, ähnlich wie ein Magnet eine gewisse Anziehungskraft auf PFAS-Moleküle aus und binden diese aus dem durch den Zylinder fließenden Wasser. Weil es sich dabei um Abfallprodukte anderer Industrien handelt, die anderweitig kaum zu verwenden sind, ist die Herstellung der Kügelchen besonders preiswert. Nach einer Zeit haben die weißen Kügelchen viel PFAS gebunden und müssen ausgetauscht werden. Bei Lorente Sanchez würden die Klärwerke dann neue Kügelchen erhalten. An diesem Geschäftsmodell zeigt sich, wie aus wissenschaftlicher Forschung eine praktische, tragfähige Lösung zum Wohle der Allgemeinheit werden kann – ein Beispiel dafür, dass sich ökonomische und ökologische Ziele nicht ausschließen müssen.




Doch um sie in die Praxis umzusetzen, braucht es Geld. „Wenn ich mich an Risikokapitalgeber wende und erkläre, dass wir im Labor die hohe Wirksamkeit unserer Methode bewiesen haben, heißt es: Schöne Idee, aber woher wissen wir, ob es auch in Kläranlagen funktioniert? Wir brauchen einen Kostenplan, wir brauchen weitere Forschung in der Praxis – wir brauchen die Gewissheit, dass Du das hochskalieren kannst“, sagt Lorente Sanchez. Er zuckt mit den Schultern, etwas ratlos. „Genau um das zu zeigen, brauche ich aber Geld“, sagt er.
Die Förderung
Es ist ein Abgrund, wie er sich in Deutschland in der Forschung immer wieder auftut: Die Wirksamkeit im Labor ist bewiesen, aber es fehlen die Mittel, um die Praxistauglichkeit weiter zu prüfen und auf eine nachhaltige Anwendung hinzuarbeiten. Die Förderung der Joachim Herz Stiftung im Rahmen der innovate! academy schließt diese Lücke gleich auf zweierlei Weise.
Schon bevor die Seminare starteten, habe sich sein Mindset geändert, sagt Lorente Sanchez. Er macht eine weit ausladende Geste und deutet auf die Laborbank: „Bei der Forschung im Labor geht es mir nicht allein um die Erkenntnis, wie es in der Grundlagenforschung der Fall ist. Ich wollte immer auch eine praktische Anwendung haben. Daher denke ich im Kopf schon eine Stufe weiter: Es geht nicht nur um die Anwendung, sondern darum, dass die Forschungsergebnisse nachhaltig in der Praxis wirken und hierfür eine marktgängige Umsetzung zu finden“, so Lorente Sanchez.
Fehlschläge als Chance
So hatte er mit seinen Kollegen, unter ihnen der Juniorgruppenleiter Dr. Olaf Wagner und die Chemikerin Ana Zidar, anfangs keine Kügelchen produziert, sondern eine Art Schwamm, ähnlich wie ein Wattepad. „Der hat wunderbar funktioniert. Aber uns war schnell klar, dass er niemals für den Einsatz in der Wasseraufbereitung geeignet wäre: Er war zu aufwändig zu produzieren, und das Wasser floss zu langsam hindurch.“
“Wir hatten alle Arten von Fehlschlägen, die man sich vorstellen kann. Aber der Moment, als es dann geklappt – das hat für alles entschädigt, pures Forscherglück!”
Alejandro Lorente Sanchez
Also experimentierte Lorente Sanchez im Labor mit praktikableren Lösungen. Die Idee mit den Kügelchen, die man auch einfach austauschen konnte, war schnell da. Aber es dauerte, bis er einen Weg gefunden hatte, sie zu produzieren. Lorente Sanchez öffnet eine Schublade und holte eine Reihe von Tütchen hervor: In einer sind zusammengeklumpte Kügelchen, in einer anderen längliche Stäbchen, in einer weiteren ist Pulver. Lorente Sanchez lacht. „Wir hatten alle Arten von Fehlschlägen, die man sich vorstellen kann. Aber der Moment, als es dann geklappt hat und wir gesehen haben, dass die Kügelchen PFAS wunderbar binden – das hat für alles entschädigt, pures Forscherglück!“
Es wird höchste Zeit, das Verhältnis zu Plastik umzustellen
Lorente Sanchez glaubt fest daran, dass seine Technologie ihren Weg in die Praxis finden kann – dank der innovate! academy sieht er nun einen Weg dorthin. Das reiche zwar nicht aus, um das globale PFAS-Problem in den Griff zu bekommen, sagt Lorente Sanchez: „Wir benutzen einen Plastikbecher 10 Sekunden lang – aber bis er wieder abgebaut wird, dauert es weit mehr als 100 Jahre. Es wird höchste Zeit, dass wir unser Verhältnis zum Plastik umstellen und es bewusster und zurückhaltender verwenden.“ Aber zugleich braucht es eben auch neue Wege, um die PFAS, die bereits im Wasser zirkulieren, wieder herauszuholen. Einen solchen neuen Weg beschreitet der Chemiker. Es ist sein Beitrag, um den Fluch der Ewigkeit, der an PFAS haftet, zumindest ein Stück weit zu brechen.
Die Reportage hat der Journalist Christian Heinrich für die Joachim Herz Stiftung erstellt.
