"Erklär' uns Deine Forschung"
Wissenschaftskommunikation zu ökonomischen Fragen
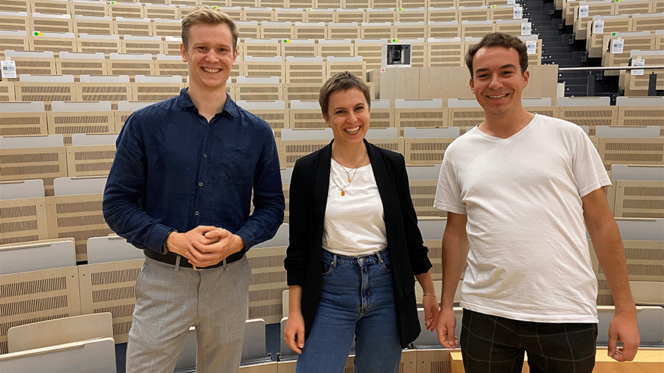
Wenn angehende Journalist:innen und Nachwuchswissenschaftler:innen zusammentreffen, lernen beide Gruppen voneinander. Gemeinsam tragen sie dazu bei, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Thema einer breiteren Diskussion in der Gesellschaft werden können. Das ist der Ausgangspunkt unserer Kooperation mit der Kölner Journalistenschule für Wirtschaft und Politik zur Förderung der Wissenschaftskommunikation.
Hintergrund der Kooperation
Wir möchten junge Wirtschaftswissenschaftler:innen dazu befähigen und ermutigen, interdisziplinär zu forschen und ihre Projekte bekannt zu machen. Ein zentraler Inhalt der Ausbildung an der Kölner Journalistenschule (KJS) ist es, wissenschaftliche Inhalte verständlich zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee für einer Kooperation der beiden Organisationen: Nachwuchsjournalist:innen der KJS führen Interviews mit jungen Wirtschaftswissenschaftler:innen, die von der JHS gefördert werden, zu deren aktuellen Forschungsprojekten.
Ziele des Projektes sind das Training von Interviewsituationen für Forscher:innen und Journalist:innen, die Erstellung von Videointerviews zur Wissenschaftskommunikation sowie die langfristige Etablierung von Netzwerken zwischen Wissenschaft und Forschung. Nach dem erfolgreichen Auftakt in 2022 wird die Kooperation in 2024 fortgesetzt.
Dr. Christina Strobel: Die versteckten Kosten der Automatisierung
Dieser Film wird bei YouTube gehostet. Das Video wird erst nach Anklicken des Buttons aktiv. Bitte beachten Sie, dass es dabei zur Übermittlung von Daten in die USA mit unsicherem Datenschutzniveau kommt.
Um was geht es in der Forschung?
Künstliche Intelligenz kann Geschäftsprozesse vereinfachen und so gesellschaftlichen Nutzen schaffen - sie birgt aber auch Gefahren und versteckte Kosten. Dr. Christina Strobel untersucht, mit welchen Szenarien wir in unserem Arbeitsleben konfrontiert sind und ob sich Menschen in Situationen, in denen ein automatisiertes System eine Aufgabe übernimmt, die normalerweise von einem Menschen ausgeführt wird, anders verhalten. Mit Hilfe eines Experiments zeigt sie, wie sich die Leistung von Arbeitnehmern verändert, wenn ein automatisierter Prozess die Bewertung ihrer Arbeit übernimmt. Beim Einsatz von KI-Anwendungen gilt es daher die Vorteile wie Zeit- und Kostenersparnis mit anderen versteckten Kosten der Automatisierung abzuwägen.
Dr. Jonas Löbbing: Progressive Einkommenssteuern und technologischer Wandel
Dieser Film wird bei YouTube gehostet. Das Video wird erst nach Anklicken des Buttons aktiv. Bitte beachten Sie, dass es dabei zur Übermittlung von Daten in die USA mit unsicherem Datenschutzniveau kommt.
Um was geht es in der Forschung?
Dr. Jonas Löbbing erforscht die sozialen Auswirkungen des technischen Fortschritts. Während dieser Fortschritt einerseits unser Leben erleichtert und industrielle Prozesse optimiert, führt er andererseits auch zu wachsender Ungleichheit, wenn beispielsweise Arbeitsplätze durch eine fortschreitende Automatisierung wegfallen. Im Interview erklärt Löbbing, warum die häufig geforderte Robotersteuer weder Arbeitsplätze noch das Wirtschaftswachstum retten wird und warum Regierungen stattdessen auf eine progressivere Einkommenssteuer setzen sollten. Seine Forschung zeigt auch, wie eine solche Steuer Unternehmen dazu motiviert könnte, in die Forschung und Entwicklung sozialverträglicheren Technologien zu investieren, ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Mit anderen Worten: Technologien entwickeln, die Arbeitgeber:innen nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, sondern sie produktiver machen.
Tobias Kircher: Datenschutz und Innovation: Zielkonflikte auf mobilen Pattformen
Dieser Film wird bei YouTube gehostet. Das Video wird erst nach Anklicken des Buttons aktiv. Bitte beachten Sie, dass es dabei zur Übermittlung von Daten in die USA mit unsicherem Datenschutzniveau kommt.
Um was geht es in der Forschung?
Einer der wesentlichen Zielkonflikte von mobilen Plattformunternehmen wie Google und Apple ist das Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Innovation. Mobile Plattformunternehmen benötigen sowohl Nutzer:innen als auch App-Entwickler:innen, um ihre Plattformen am Markt durchzusetzen. Nutzer:innen machen ihre Entscheidung darüber, welches Smartphone sie kaufen, oft vom Datenschutz abhängig, um ihre Privatsphäre zu schützen. Gleichzeitig benötigen App-Entwickler:innen die Daten, um Entwicklungen zu finanzieren und Apps mit innovativen Features, wie beispielsweise künstlicher Intelligenz auszustatten. Mithilfe eines natürlichen Experiments zeigt Tobias Kircher, wie sich Datenschutz auf die Innovationsleistung von App-Entwickler:innen auswirken kann und mit welchen Auswirkungen mobile Plattformunternehmen rechnen müssen.
Was waren die Erfahrungen der Teilnehmenden?

Wir haben die Wissenschaftlerin Dr. Christina Strobel und die beiden Journalisten Dominik Jäger und Helge Hoffmeister beim Dreh an der TU Hamburg begleitet. Wie haben sie die Zusammenarbeit erlebt? Welche Erfahrungen haben sie gemacht?

Dr. Christina Strobel
"Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich habe definitiv auch viel mitgenommen. Eine Sache, die mir spontan einfällt ist, dass sich komplexe Sachverhalte einfach und kompakt darstellen lassen. Da haben mich Helge und Dominik wirklich überrascht! Ich habe ihnen meine Forschung erklärt und die beiden haben das wirklich in zwei, drei Sätzen prägnant formuliert. Das war auf jeden Fall ein Learning, was ich mitnehme. Die andere Sache, die ich gelernt habe, ist: Beispiele helfen. Das ist in der Theorie bekannt, aber ich habe nochmal gemerkt, dass sich dadurch die komplexen Sachverhalte besser erklären lassen und für das Verständnis förderlich sind."

Dominik Jäger
"Als Journalistinnen und Journalisten brauchen wir ja immer Zahlen und Daten und diese müssen uns immer externe Personen für unsere Artikel liefern. Und durch die Kooperation war es richtig schön, auch mal die Menschen, speziell Christina, hinter den Studien und Zahlen kennenzulernen. Gelernt haben wir u. a., warum Wissenschaftler:innen oft so abwägend kommunizieren. Wir als Journalist:innen wollen gerne die eine, absolute Aussage - also das wird so und so eintreffen. Jetzt haben wir verstanden, dass die Forschung immer nur einen momentanen Zustand abbilden kann und sich immer wieder etwas ändert. Daher quasi eine Art "Exit-Strategie" und die Aussagen dazu relativierender ausfallen."

Helge Hoffmeister
"Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass die wissenschaftlichen Felder unglaublich vielfältig sind und, dass es eben auch viele versteckte Themen gibt, die für uns Journalist:innen interessant sein können. Aber dass eben auch entscheidend ist, dass die Kommunikation zwischen den Wissenschaftler:innen und Journalist:innen besteht. Das heißt, dass man eben noch mehr Ausschau hält nach wissenschaftlichen Arbeiten, die aktuell veröffentlicht werden und dass man als Journalist auch in den Kontakt mit Wissenschaftler:innen tritt - auch, weil die Leute dahinter nämlich meistens super freundlich sind."